Newsletter Service
Mit unserem Newsletter erhalten Sie stets aktuelle Hintergrundinformationen über die Energiewirtschaft in Deutschland.
Auf politischer Ebene ging bei Wasserstoff in den letzten Monaten einiges voran, sowohl in Deutschland als auch in der EU. Im Interview ordnen Eva Hennig, Leiterin Energiepolitik EU bei Thüga, und Markus Wörz, Leiter Energiepolitik Deutschland bei Thüga, die jüngsten Entscheidungen ein.

Eva Hennig: 2022 ist Wasserstoff definitiv im Mainstream gelandet. Der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine hat die Entwicklung beim Wasserstoff noch weiter beschleunigt. Sehr große Investoren – auch aus der Öl- und Gasbranche – kündigen eine Investition nach der anderen in große Wasserstoffprojekte mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro an. Seit letztem Jahr bin ich überzeugt davon, dass der Point of Return überwunden ist, dafür wird zu viel Geld in die Hand genommen. Auf diesen Moment haben wir immer gehofft.

Markus Wörz: In Deutschland sehen wir weniger Scheuklappen, weniger Verbote. Diese Öffnung zeigt sich in der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS). Sie lässt mehr Wasserstoff-Farben zu, neben grünem auch blauen und orangen Wasserstoff, der aus Biogas oder Abfall gewonnen wird. Die nationale H2-Erzeugung wurde von fünf auf zehn Gigawatt ausgeweitet. Und im Wärmebereich ist jetzt analog zu Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Wärmeplanungsgesetz Wasserstoff grundsätzlich zulässig. Kommunen können in ihrer Wärmeplanung Wasserstoffnetzausbaugebiete ausweisen. Das ist ein großer Fortschritt gegenüber dem ersten Entwurf.
Hennig: Die EU-Kommission wird von den aktuellen Entwicklungen überrollt, der Widerstand gegen Wasserstoff bröckelt. Trotzdem bleibt vor allem Wasserstoff im Wärmesektor in Brüssel eine hitzige Diskussion. Mehrere Verbände haben eine Allianz gebildet, die das Thema intensiv bearbeiten. Und seit der ersten Veröffentlichung des GEG und der anschließenden Medienschlacht blicken alle bei dem Thema nach Deutschland. Diverse Gasgerätehersteller haben ihre Strategieentscheidungen auf Eis gelegt, bis das GEG im Bundesanzeiger steht.
Hennig: Da ist die Dynamik gerade groß. Der internationale Wettbewerb nimmt Fahrt auf. In Europa hat Großbritannien in seiner Wasserstoffstrategie bereits den geplanten Gigawatt-Export nach Europa verankert. Dazu kommen Norwegen, Dänemark, Schweden und seit neuestem Finnland. Die Nordsee ist von Pipelines durchzogen, was ein riesiger Vorteil ist. In den letzten zwölf Monaten hat sich Portugal stark entwickelt. Deutschland und Spanien haben den Bau einer Leitung durch das Mittelmeer vereinbart. Auch in Osteuropa steigt das Interesse. Wenn der Krieg in der Ukraine beendet ist, werden sehr viele Gelder zum Aufbau der dortigen Wirtschaft fließen und die Ukraine kann perspektivisch eines der Produktionsländer sein, was über ein sehr potentes Pipelinenetz an Zentraleuropa angebunden ist.
Wörz: Das ist ein interessanter Vorgang, denn die Rechtsgrundlage EnWG für das Wasserstoffkernnetz ist noch im Entwurfsstadium. Hier merkt man, die Zeit drängt, das Wirtschaftsministerium macht Druck. Auf der einen Schiene wird ein Gesetz geändert, um dieses Kernnetz zu ermöglichen, parallel arbeiten die Fernleitungsbetreiber bereits an ihren Planungen.
Was noch fehlt und worauf wir starken Wert legen, ist die Phase zwei des Kernnetzes, in der die Verteilnetze und damit Industrie, Gewerbe sowie Haushaltskunden angeschlossen werden. Außerdem gibt es beim Wasserstoffkernnetz einige weiße Flecken auf der Landkarte. Hier setzen wir uns für eine Aufnahme dieser Gebiete in die Planungen ein.
Wörz: Fakten schaffen die LNG-Terminals, also Floating und künftige festinstallierte Terminals, die alle auf H2-Readiness ausgelegt sind. Über die dort getätigten Investitionen haben wir sehr gute Import-Kapazitäten, sodass wir gar nicht mehr vom Molekül H2 wegkommen werden.
Hennig: Die LGN-Terminals sind der Beginn des Imports. Seit dem Ukrainekrieg hat sich Europa dem amerikanischen „Freedom Gas“ geöffnet, das sehr lange verschmäht wurde. Da ist der Export von grünem und blauen Wasserstoff der logische nächste Schritt.
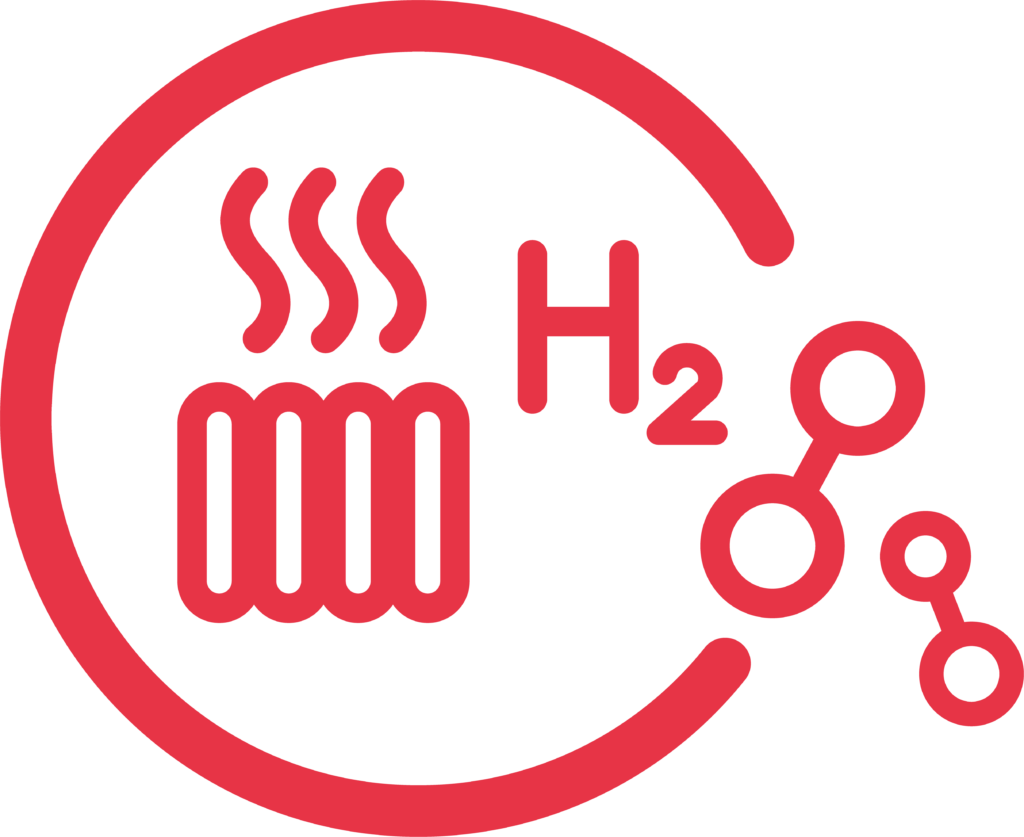
Wörz: Energieversorger müssen handeln, Transformationspläne aufstellen und Pilotprojekte initiieren, um die Potenziale von Wasserstoff vor Ort sichtbar zu machen. Nur so bekommen wir die kommunale Ebene für eine klima- und wirtschaftspolitisch sinnvolle Transformation auf unsere Seite. Diese Überzeugungsarbeit ist auch Aufgabe der neuen H2-Plattform, zu der sich Thüga und zehn Partnerunternehmen zusammengeschlossen haben. Ein Verzicht auf die Gasnetze und damit wegfallende Ergebnisse ließe sich für Energieversorger nur teilweise durch Strom kompensieren. Deshalb dürfen wir bei unseren Bemühungen in der Interessenvertretung nicht nachlassen. Parallel sollten wir uns stärker auf Erneuerbare Energien und die Netze fokussieren.
Hennig: Eine Dekarbonisierung mit Wasserstoff und Biomethan ist ein echter Marathon, das benötigt Personal, Knowhow, viel Geduld und auch Geld. Das Tolle an der Thüga-Gruppe ist doch, dass nicht alle die gleichen Themen parallel bearbeiten müssen, sondern dass die Unternehmen an den Erfahrungen untereinander partizipieren können. So wie mit unserer ersten Elektrolyse vor zehn Jahren in Frankfurt. Aber: Wenn das GEG und das Gesetz zur Wärmeplanung verabschiedet sind, werden alle Partner-Unternehmen einen Gasnetzgebietstransformationsplan aufstellen müssen. Damit sollten alle dieses Jahr unbedingt beginnen, denn es ist einiges an Arbeit.